Wirtschaftsinformatik
Hier möchte ich die von Prof. Rautenstrauch heißgeliebten Definitionen
zur Wirtschaftsinformatik darstellen, auf die er soviel Wert legt. Außerdem
sollen chronologisch wichtige Zusammenhänge gezeigt werden, die auch eher
am Rand der WI stehen. Diese Zusammenfassung soll das Skript nicht ersetzen,
sondern zu Lernzwecken ergänzen. Auf vielfachen Wunsch gibt es jetzt auch
mehr Bilder. Ich beziehe mich dabei auf sein Skript.
Da auch dort nicht alles drin steht *g*, kommt auch noch einiges aus "Wirtschaftsinformatik
1" von Hansen und Neumann dazu.
Sollte einer der Herausgeber etwas gegen die Verwendung seines Materials haben,
bitte ich darum, mir dies mitzuteilen. Ich werde dementsprechende Konsequenzen
ziehen und jeden Verweis bzw. jeden Auszug entfernen.
Inhalt
- Wirtschaftsinformatik
- Integration
- Architekturen
- CORBA
- Frameworks und Fachkomponenten
- Betriebliche Anwendungssysteme
- Forschung und Entwicklung
- Vertrieb
- Unterstützung des
Kundenkontakts
- Angebotsüberwachung
- Auftragserfassung und Prüfung
- Beschaffung
- Lagerhaltung
- Versand
Wirtschaftsinformatik
Wirtschatsinformatik (WI) befasst sich mit der Konzeption, Entwicklung,
Einführung, Wartung und Nutzung von Systemen, in denen die computergestützte
Informationsverarbeitung (IV) im Unternehmen angewandt wird. Man spricht auch
von betrieblichen Anwendungssystemen und bringt damit gleichzeitig zum Ausdruck,
dass sie dem Anwender im Unternehmen bei der Bewältigung seiner Aufgaben
helfen.
WI ist die Wissenschaft von den Informations- und Kommunikationssystemen
in Wirtschaft und Verwaltung.
WI ist die Wissenschaft von Entwurf, Entwicklung und Einsatz computergestützter
betriebswirtschaftlicher Informationssysteme.
WI ist die Wissenschaft von Konzeption, Entwicklung, Einführung,
Nutzung und Wartung rechnergestützter betrieblicher Informationssysteme.
Wirtschaftsinformatik (Business Information Systems) = Betriebsinformatik (Information
Systems) = Betriebliche Datenverarbeitung ( Business Informatics).
Ein System ist das Modell einer Ganzheit,
- die Beziehungen zwischen Attributen aufweist,
- die aus miteinander verknüpften Teilen besteht,
- und die von ihrer Umgebung abgegrenzt wird.
Informationsinfrastruktur sind die Einrichtungen, Mittel und Maßnahmen
zur Produktion, Verbreitung und Nutzung von Informationen im Unternehmen. Frage:
Wie kann Informationsinfrastruktur so geplant, realisiert, überwacht und
gesteuert werden, dass sie bestmöglich zur Erreichung strategischer
Unternehmensziele beiträgt?
Aufgaben der WI
- Beschreibung: Voraussetzung für Erklärung und Gestaltung, Ziel
ist das in der Wirklichkeit Beobachtete systematisch zu dokumentieren
- Erklärung (der für den Wifler relevanten Wirklichkeit): Ergebnis
sind Modelle als Menge von Aussagen, die untereinander in einem Begründungszusammenhang
stehen
- Gestaltung: Wirklichkeit so verändern, dass ein bestimmter Sollzustand
erreicht wird, Gestaltung mit dem Ziel des Erkenntnisgewinns
- Prognose: Vorraussagen über Verhalten und Zustände von Informationssystemen
Denkmethoden in der Forschung: theoritisierend, "gedankenexperimentell":
Induktion (Herleitung allgemeiner Aussagen aus Einzelbeobachtungen) und
Deduktion (Schlussfolgerung spezieller Aussagen aus allgemeinen Aussagen,
geringer Neuigkeitsgehalt, geringer Unsicherheitsgrad).
Feldforschung ist die Untersuchung der Betrachtungsobjekte in ihrer
natürlichen Umgebung. Vorteil: Nähe zur Wirklichkeit. Probleme: Beherrschung
der Randbedingungen im Feld, Zugang zu den Betrachtungsobjekten.
Laborforschung ist die Untersuchung der Betrachtungsobjekte in einer
künstlich geschaffenen Umgebung.
Experimentelle Forschung: durch den Forscher erfolgt ein Eingriff in
die Wirklichkeit, Kontrolle von Störgrößen (Ceteris-paribus-Klausel:
"Unter ansonsten gleichbleibenden Bedingungen)
Nicht-experimentelle Forschung: der Forscher beschränkt sich auf
die Beobachtung der Wirklichkeit
Eine Menge zusammengehöriger und aufeinander aufbauender Aussagen (diesen
sind Wahrheitswerte zuordenbar) wird als Theorie bezeichnet.
Information ist handlungsrelevantes Wissen.
Wissen ist die Gesamtheit der Kenntnisse auf einem bestimmten Gebiet.
Daten sind zum Zwecke der Verarbeitung zusammengefasste Zeichen.
Eigenschaften:
- Daten können mehrfach ohne Abnutzung zur "Produktion" von
Information verwendet werden
- diese kann verändert werden, ohne dass diese Veränderung an den
genutzten Daten erkennbar ist
- der Wert von Daten hängt von ihrer Verwendung zur Produktion von Information
ab
- der Wert von Daten kann durch Bearbeitung, Speicherung und Weiterleitung
verändert werden
- Information verursacht Kosten, die von der Art der Beschaffung, Bearbeitung
, Speicherung und Weiterleitung der verwendeten Daten abhängen
- der Wert von Daten kann durch zweckmäßige Verwendung zur Produktion
von Information steigen
- Daten und Informationen können beliebig verdichtet werden
- Daten können missbraucht werden !
- Daten können auf einfache Weise vervielfältigt werden
- Information kann mit annähernder Grenzgeschwindigkeit (Licht~) verbreitet
werden
- Information hat einen Lebenszyklus (Datenentstehung, Verteilung, Informationsverwertung)
- Information ist beliebig teilbar
Kommunikation ist ein Prozess zur Übertragung von Nachrichten zwischen
Sender und einem oder mehreren Empfängern.
Eine Nachricht ist die Folge von Zeichen zur Übermittlung von Daten.
Sie gehorcht einer Syntax (Erlaubte Zeichen und deren Verknüfung zu Worten
und Sätzen, verschiedene Zeichensätze möglich), einer Semantik
(Beziehung zwischen Zeichen, Wörtern, Sätzen und deren Bedeutung),
und der Pragmatik (Beziehung zwischen Zeichen, Wörtern, Sätzen und
den damit verbundenen Handlungen).
Die betriebliche Informationsfunktion ist die Gesamtheit der Aufgaben
(in einem Unternehmen), die sich mit Information als Produktionsfaktor befassen.
Sie durchdringt betriebliche Grundfunktionen wie Beschaffung, Produktion oder
Absatz und Querschnittsfunktionen wie Rechnungswesen, Personal oder Controlling
gleichermaßen.
Der Zweck von Informationssystemen / einer Informationsinfrastruktur
ist: die Schaffung und/oder die Umsetzung des Leistungspotentials der Informationsfunktion
in Unternehmenserfolg möglichst wirksam und wirtschaftlich zu unterstützen.
Integration
Integration ist die Schaffung einen (neuen) Ganzen aus (ehemals) isolierten
Elementen.
Das Ziel der Integration / IT in Unternehmen ist die Gestaltung der
Informationsinfrastruktur eines Unternehmens derart, dass sie einen möglichst
hohen Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet. Zu ihren Leistungen zählen
u.a. die Erhöhung der Produktivität, die Verbesserung der Qualität
von Leistungen des Unternehmens, die Verringerung von Durchlaufzeiten von Vorgängen
und nicht zuletzt die Ausschöpfung von Kostensenkungspotentialen. Erwerbswirtschaftliches
Prinzip dabei: bei gegebenen Kosten Leistung optimieren.
Aufgabenintegration
- Abkehr vom Taylorismus (Spezialisierung)
- Arten: Horizontal (Aufwärts, Abwärts), Vertikal
Funktionsintegration
- Funktion hier: Betriebliche Aufgabe, die computergestützt durchgeführt
wird
- Vorteile: Wegfall von Übergangs- und Einarbeitungszeiten, Fehlerquelle
Mensch wird reduziert
Datenintegration:
- Nutzung einer gemeinsamen Datenbasis durch alle betrieblichen Anwendungssysteme
- Integration der Datenmodelle (Unternehmensdatenmodell als Ideal)
- Vorteile: Redundanzvermeidung, ständige Datenaktualität, reduzierter
Erfassungsaufwand
==> EIN integriertes Betriebliches Informationssystem mit
- Daten- und
- Funktionsintegration
- weitere Objekte der Integration: Objekte, Methoden, Softwaresysteme bzw.
Programme, Vorgänge, Geschäftsprozesse
Integrierte Informationssysteme (IIS)
Entstehung durch
- vollständige Neuentwicklung eines umfassenden IIS
- nachträgliche Integration bestehender Informationssysteme
- Entwicklung integrationsfähiger Einzelsysteme, die schrittweise miteinander
integriert werden
Neuentwicklung von IIS: Information Engineering
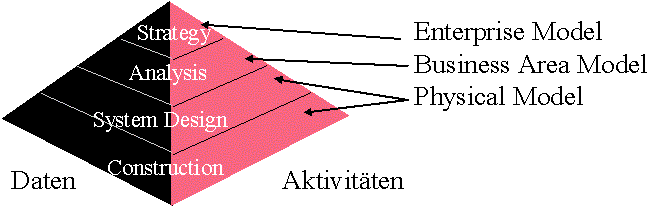 Nach Martin 1989 - 91, "Grüne-Wiese-Ansatz"
Nach Martin 1989 - 91, "Grüne-Wiese-Ansatz"
Probleme bei der schrittweisen Integration in Altsystemen:
- Inkompatible Modelle
- Heterogenität: unterschiedliche Basistechnologien (Computersysteme,
Betriebssysteme, Netzprotokolle, Datenbanksysteme, Benutzeroberflächen
usw.); unterschiedliche Paradigmen, auf deren Basis die Softwaresysteme entwickelt
wurden (z.B. prozedurale, wissensbasierte, objektorientierte, datenbankbasierte
Sprachen); unterschiedliche Formen der Informationsaufbereitung und -darstellung
(Daten, Texte, Grafiken, multimediale Darstellungsformen usw.)
Lösungsansätze zur Aufbereitung von Altsystemen:
- Integrationsorientiertes Reengineering
Ansätze für Neusysteme: (Integration Engineering)
- Schaffung einer geeigneten Informationssystemarchitektur
- Modellierung der Systeme (Fachkonzepte als Mittel zwischen BWL und Informatik)
- Systematische Komposition von Einzelsystemen: Einzelprojekte haben einen
überschaubaren und handabbaren Umfang; die Integration von (aufbereiteten)
Altsystemen und zukünftigen Neuentwicklungen ist von vorne herein vorgesehen;
für jede Teilaufgabe können die hierfür technisch am besten
geeigneten Entwicklungswerkzeuge eingesetzt werden
Vorteile von Integrierten Informationssystemen gegenüber Insellösungen:
- künstliche Grenzen zwischen Abteilungen werden zurückgedrängt
- der Aufwand für die Datenerfassung wird auf die einmalige Erfassung
von Primärdaten beschränkt
- moderne betriebswirtschaftliche Konzepte wie eine Kostenplanung auf Basis
realer Vergangenheitswerte oder Prozesskostenrechnung können implementiert
werden
- die Datenqualität wird durch die Vermeidung redundanter Erfassung verbessert
- Teilprozesse werden dank automatisierter Abarbeitung nicht mehr "vergessen"
- Redundanzvermeidung führt zu einer Senkung des Speicher- und Dokumentationsaufwandes
- fehlerhafte Daten können leichter durch häufige und verschiedenartige
Nutzung entdeckt werden
- Schaffung eines Rahmens für die Vermeidung lokaler Suboptima
Probleme von IIS:
- Fehlerfortpflanzung
- auch wirtschaftlich wenig sinnvolle Automatisierungen müssen ggf. vorgenommen
werden, damit eine durchgängige Integration erreicht wird
- das Testen integrierter Anwendungssysteme ist sehr aufwendig
- zwischen der oftmals hohen Investition in eine IIS und dem Beginn der Amortisation
liegt in der Regel eine enorme Zeitdifferenz
- geeignetes Personal ist kaum verfügbar (na ob
das noch stimmt?!?)
Architekturen
Bei Monolithischen Systemen bilden Funktionalität und Datenverwaltung
eine untrennbare Einheit, sie gelten als integrationsfeindlich.
Beim Client-Server-Konzept werden Softwaresysteme in Anbieter (Server)
und Nachfrager (Clients) von Software-Dienstleistungen eingeteilt. Diese Einteilung
wird oft auch auf die Hardware übertragen: Rechner, die (Software-)Dienste
anderen Rechnern (Clients) anbieten, werden "Server" genannt. Jedoch
können Server und Client sich auch auf einem Rechner befinden!
Merkmale von Client-Server-Systemen:
- Kommunikation findet stets zwischen Clients und Servern statt
- die Initiative für die Interaktion zwischen Client und Server geht
immer von Client aus
- tritt zwischen Nachfragen mehrerer Clients ein Konflikt auf, so entscheidet
stets der Server, welche Strategie zur Auflösung des Konflikts angewendet
wird
- Skalierbarkeit von Software und Hardware
- Alternativen: Peer-to-peer (alle sind gleichberechtigt, jeder kann mit jedem
kommunizieren); Broadcasting (Rechner können nur zuhören)
Drei-Schicht-Client-Server-Architektur
- Präsentation: Zusammenfassung aller Funktionen, die dem Benutzer unmittelbar
bereitgestellt werden; Verwaltung von Fenstern, Menüs, Eingabefeldern
usw.; Eventhandling
- Verarbeitung: Funktionen zur Unterstützung der von dem Anwendungssystem
zu bewältigenden Aufgaben
- Datenhaltung: Eingabe, Änderung, Löschung und Abfrage von Daten;
bei speziellem Datenbankserver hardwaremäßig getrennt vom restlichen
System
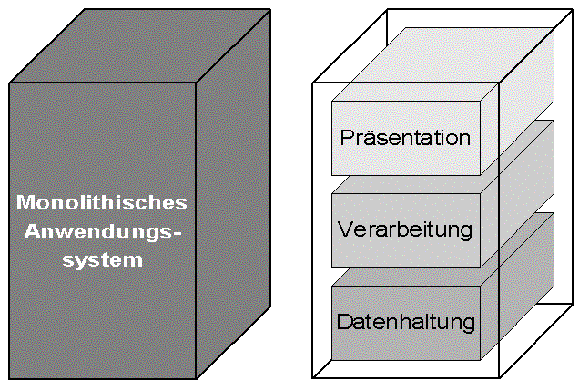 Monolithisches
System vs. 3-Schicht-Client-Server-System
Monolithisches
System vs. 3-Schicht-Client-Server-System
Als Application Server wird ein Teilsystem des Integrierten Informationssystems
(IIS) bezeichnet, in dem anwendungsübergreifende Funktionalität gekapselt
wird. Dieser kann auf Basis Aktiver Datenbanksysteme oder als eigenständige
Middleware implementiert werden.
Grundidee:
- in IIS gibt es anwendungsübergreifende (globale) Funktionen (solche
Funktionen, die von mehr als einem Anwendungssystem verwendet werden), die
nicht-redundant implementiert werden müssen
- Funktionenredundanz birgt die Gefahr, dass gleiche Funktionen in unterschiedlichen
Programmen unterschiedliche Ergebnisse liefern
- Geschäftsregeln
Geschäftsregeln
- unternehmensextern: (Natur-)Gesetze, gesellschaftliche Normen
- unternehmensintern: Organisationshandbücher, Verträge, AGBs, Softwarespezifikationen
und -code, Know-how der Mitarbeiter
- z.B.: ein Buchungssatz darf niemals gelöscht werden, das Einstellungsdatum
eines Mitarbeiters muss immer nach dessen Geburtsdatum sein
Formale Modellierung von Geschäftsregeln:
- ECA-Tripel (Event [Condition] Action): ON <Zustandsänderung>
IF <Prädikat> DO <Prozess>
Geschäftsregel als semantische Konsistenzbedingung:
- "Die Vertriebskosten sollten nicht mehr als 10% vom Umsatz betragen."
- Problem 1: ECA-Struktur nicht erkennbar; mögliche Umformulierung: E:
Anfrage der Geschäftsleitung, C: KV > U*0,1, A: Rückmeldung an
Geschäftsleitung
- Problem 2: ECA-Struktur nicht eindeutig: alternative Formulierung: E: KV
> U*0,1, C: Geschäftsleitung ist interessiert, A: Rückmeldung
an Geschäftsleitung
- weitere Probleme: Aggregierte Begriffe ("Vertriebskosten"), "weiche"
Begriffe ("sollten nicht mehr"), ungenaue Begriffe ("Umsatz")
Aufteilung der Anwendungsfunktionalität in lokale und globale Funktionen:
- Kriterium: wie oft Wiederverwendung?
- Strategien: Top-Down: auf Basis eines Unternehmens- bzw. bereichsweiten
Funktionenmodells werden anwendungsunabhängige Funktionen direkt für
den Server implementiert; Bottum-Up: Datenbankzugriffe werden als Kandidaten
für Mehrfachnutzung (tja was hat er hiermit wohl
gemeint)
Database Application Server
- Speicherung und Ausführung von Ablauflogik durch aktives Datenbanksystem
- statische Integritätsregeln als Teil der DDL (constraints)
- dynamische Integritätsregeln als Trigger (ereignisorientiert ausgelöste
Programme)
- Stored (in der Datenbank angelegte) Procedures, Functions, Packages
Vorteile:
- Integritätssicherung erfolgt unternehmensweit
- Konzept der Schematransparenz (Clients und Server können unabhängig
voneinander entwickelt und gewartet werden; Wahlfreiheit bei Client-Systementwicklung)
- Standardisierung der Systementwicklung
- Code der Anwendungsprogramme wird entlastet (Lean Applications)
- Redundanzvermeidung bei Funktionen und Daten
- Selbsterhaltung des Systems, --> Bewahrung vor Inkonsistenz
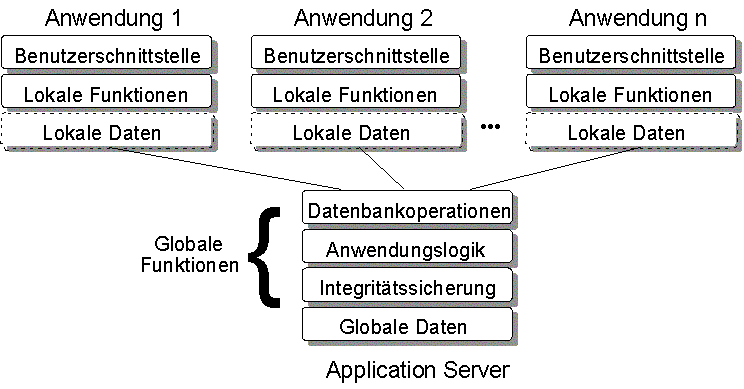 Architektur
Architektur
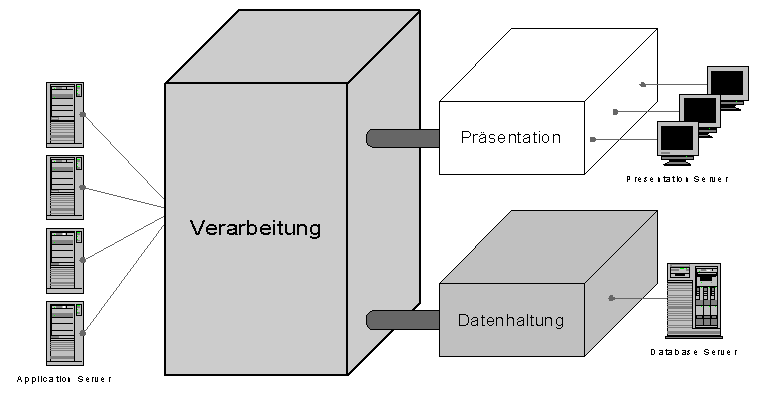 Application
Server als Middleware
Application
Server als Middleware
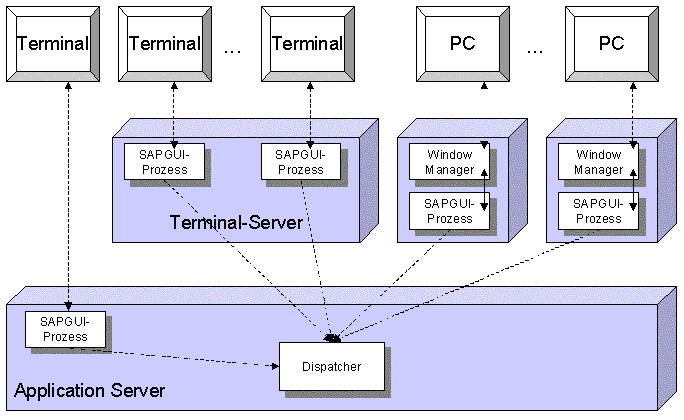 Beispiel SAP/R3
Beispiel SAP/R3
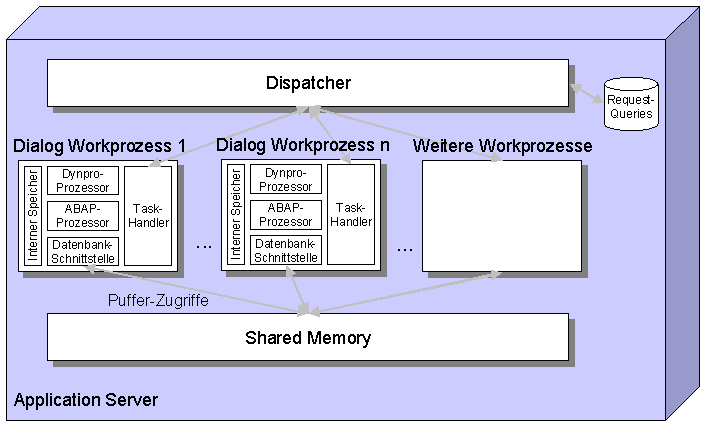 Architektur
des Application Servers
Architektur
des Application Servers
Workprozesse (eines Database Application Servers) können sein:
- Dialogprozesse für die Abarbeitung von Funktionen in Realzeit
- Verbuchungsprozesse für die Abarbeitung von Datenbanktransaktionen
(Commit and Rollback)
- Prozesse für die Sperrverwaltung bei konkurrierenden Benutzerprozessen
auf der Datenbank
- Spoolprozesse für die Druckeransteuerung
- Hintergrundprozesse für die Steuerung und Durchführung von Batch-Prozessen
(läuft allein im Hintergrund /ohne Benutzereinwirkung)
Ablauf eines Dialog-Prozesses:
- Task-Handler: übernimmt Anforderung vom Dispatcher, koordiniert die
Weitergabe an die anderen Bausteine des Workprozesses, schreibt am Anfang
eines Dialgoschrittes alle Benutzerberechtigungen in den User Context des
Shared Memory
- Dynpro-Prozessor: übernimmt die Ablaufsteuerung von Bildschirmmasken
- ABAP-Prozessor: interpretiert die ABAP-Programme (geschrieben in Advanced
Business Application Programming-Language, SAP-interne Programmiersprache)
und führt sie aus
- Datenbankschnittstelle: reicht Datenbank-Anfrage an den Shared Memory
Als Workflow wird ein Teil eines Geschäftsprozesses bezeichnet,
der sich aus sequentiell oder parallel angeordneten Tätigkeitsfolgen (Aktivitäten)
zusammensetzt. Er beschreibt damit Teilprozesse der Ablauforganisation von Unternehmen.
Charakteristika:
- einzelne Akivitäten eines Workflows: Funktionen, bei denen Input- in
Outputdaten transformiert werden; Logik einer Funktion wird durch ihr Programm
beschrieben
- Zustandsübergänge: unterliegen Transitionsbedingungen; Festlegung,
unter welchen Rahmenbedingungen Kontrolle von einer Aktivität einer anderen
Aktivität übergeben wird
- Durchführung von Aktivitäten: erfordert informationstechnische
Ressourcen
- Einbettung in die Aufbauorganisation
Funktionen von Workflow-Management-Systemen (WFMS)
- Modellierung von Workflows (wobei dieser Aufgabenbereich in einigen Systemen
auch in separate Module ausgelagert ist)
- Steuerung und Überwachung des Ablaufs von Anwendungssystemen
- Führen von History-Listen, mit denen Abläufe nachvollzogen und
ggf. Fehler erkannt werden können (Trace-Files)
CORBA (Common Object Request Broker
Architecture)
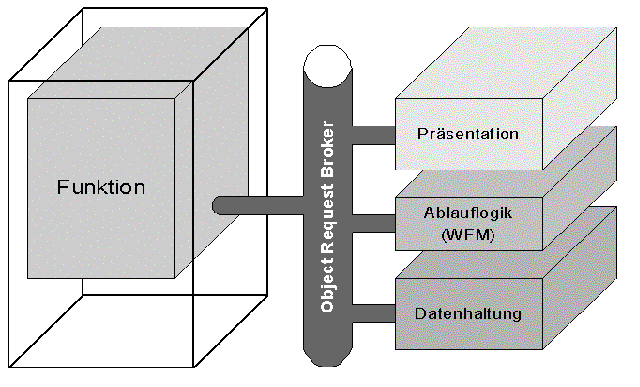 Middleware als Dienstvermittler
Middleware als Dienstvermittler
Object Management Architecture (OMA)
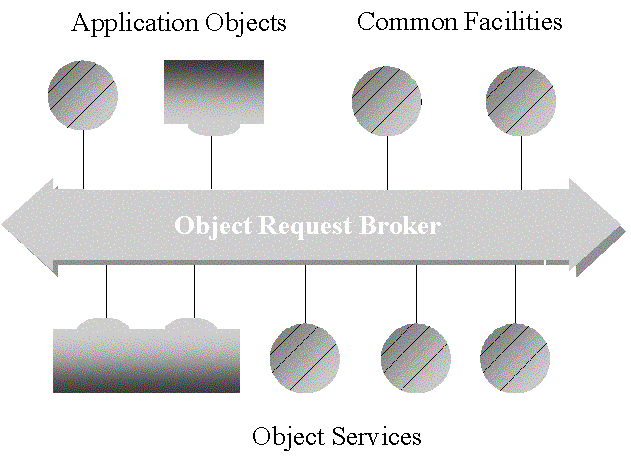
- Object Services (OS - Objektdienste): grundlegende Dienste, z.B. für
die physische Speicherung und logische Modellierung
- Common Facilities (CF - Optionale Dienste): allgemeine Dienste wie das Drucken
von Dokumenten und den Zugriff auf Datenbanken
- Application Objects (AO - Anwendungsobjekte): Anwendungsobjekte (insbesondere
Endbenutzerwerkzeuge) wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation usw.
- Object Request Broker (ORB - Objektvermittlung): implementierungsunabhängige
Dienste zur Kommunikation zwischen Objekten in verteilten Anwendungen
Objektmodell von CORBA
- Basis: Client-Server-Modell
- Client weiss nur, wie eine Dienstleistung anzufordern ist (nämlich
über den Broker), ohne dabei Interna der Implementierung zu kennen
- Broker wählt für einen angeforderten Dienst einen Server aus
- Server ist eine Objektimplementation und erbringt einen Dienst ohne Rücksicht
auf die Identität des Dienstnutzers
Elemente der Architektur
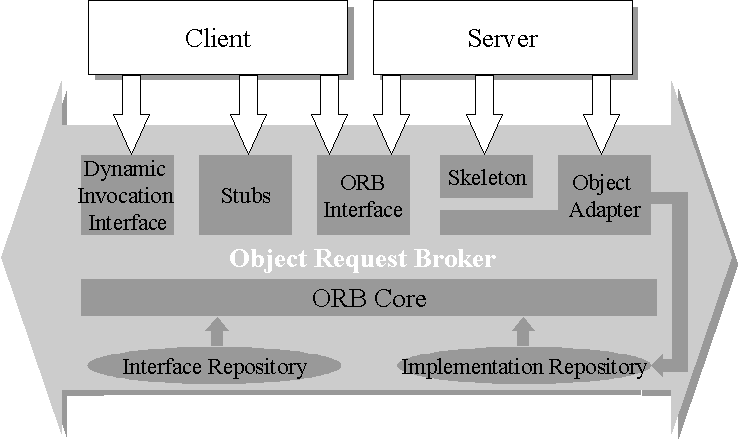
- Stubs: ein Stub wird anstelle des eigentlichen Objektes in ein Client-Programm
eingebunden, er übersetzt Aufrufe aus dem Programm in Anfragen an den
ORB und transformiert ebenso die Ergebnisse, ein Stub ist abhängig von
der benutzten ORB-Implementierung und der verwendeten Wirtssprache; die Menge
aller Stubs bezeichnet man als Static Invocation Interface (SII)
- Dynamic Invocation Interface (DII): Konstruktion von Anfragen zur Laufzeit,
Informationen über auszuführende Operationen und Typen der Parameter
können Interface Repository oder anderer Quelle entnommen werden
- ORB Core (ORB-Kern): Übermittlung einer Client-Anfrage zur passenden
Objektimplementation sowie die Rückgabe der Ausgabewerte an Client
- Skeleton: Gegenstück zu den Stubs auf der Client-Seite; Aufgaben: Bereitstellung
von Informationen für den ORB Core über die implementierten Methoden
der Server-Objekte, Weitergabe von Aufrufen des ORB Core an die Objektimplementation
und Rücksendung der Ergebnisse
- ORB-Interface: Bereitstellung von Operationen, die für alle Objekte
gleich sind und nicht von anderen Schnittstellen bereitgestellt werden
- Object Adapter: Zuordnung von konkreten Methoden der Objektimplementation
zur Ausführung und zu eintreffenden Anfragen; Erzeugen und Interpretieren
von Objektreferenzen sowie die Verwaltung des Implementation Repositories;
Bereitstellung von Funktionalität des ORB
- Interface Repository: Bereitstellung von Informationen über definierte
Schnittstellen der Client- und Server-Objektimplementation zur Laufzeit; Anwendungsentwickler
haben die Möglichkeit, über Interface Browser wiederverwendbare
Softwarekomponenten zu finden
- im Repository: 3D's: MetaDaten ("Daten über Daten"), Directory
(wo, was, wie), Dictionary (Erläuterung), Berechtigungen (wer darf was)
Frameworks und Fachkomponenten
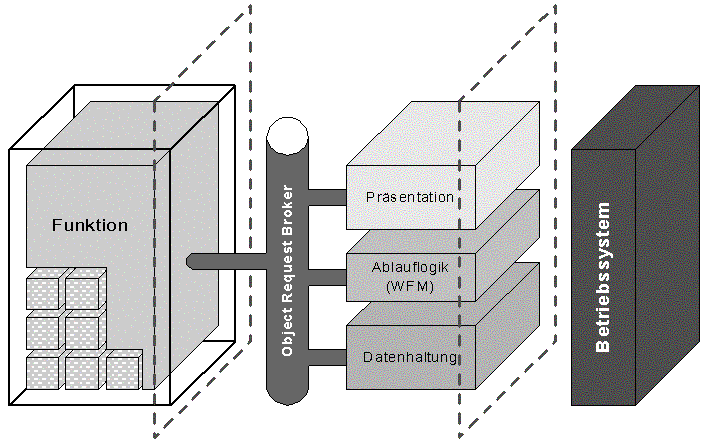
Komponente
- "Stück" Software
- wiederverwendbar
- für sich selbst stehend
- abgeschlossen: Ablauffähigkeit ist nicht vom Vorhandensein einer anderen
Komponente abhängig
- unabhängig: Komponenten und ihre Dienste sind nicht an bestimmte Anwendung
oder Laufzeitumgebungen gekoppelt
- offen: einsetzbar in unvorhersehbaren Kombinationen
- einzeln vermarktbar
- stellt seiner Umgebung Funktionen als Dienste zur Verfügung
Eine Fachkomponente ist eine spezielle Komponente, die eine bestimmte
Menge von Aufgaben einer betrieblichen Anwendungsdomäne (bestimmter Bereich
in einer Firma, z.B. ReWe, Controlling etc.) implementiert und an unternehmensspezifische
Erfordernisse angepasst werden kann.
Elemente der CoBCoM-Archiktur (Common Business Componet
Model)
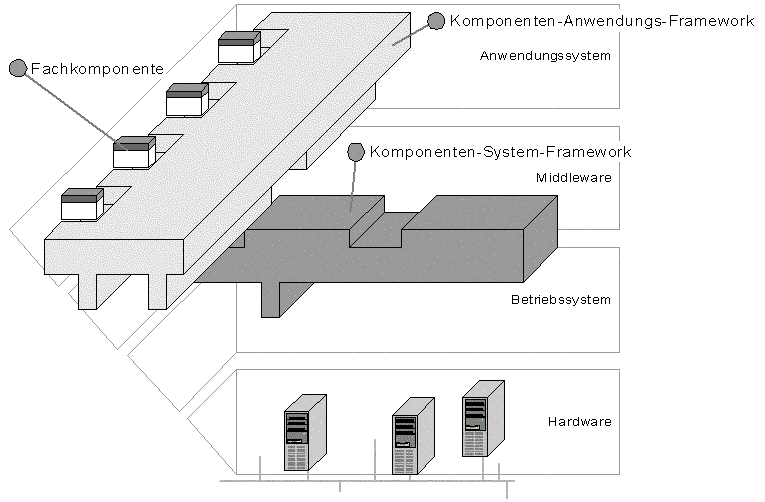
- Komponenten-System-Framework: Kapselung der domänennahen und systemnahen
Dienste (WFMS, DBMS, ORB, anwendungsinvariante Teile des Database Application
Servers)
- Komponenten-Anwendungs-Framework: Kapselung der anwendungsinvarianten und
domänenspezifischen Dienste; Integrationsplattform für Fachkomponenten
(z.B. San Francisco Framwork von IBM oder Vertical Common Facilities, OAG)
Elemente von San Francisco
- Java Virtual Machine (JVM) als Basis
- Foundation: stützt sich auf die Common Object Services der CORBA; grundlegende
Dienste wie Transaktionsmanagement und Synchronisation von Objektzugriffen
- Common Business Objects: allgemeine branchenunabhängige betriebswirtschaftliche
Funktionen (z.B. Durchführung von Buchungen in der FiBu); Schnittstelle
zu den betrieblichen Kernprozessen
- Core Business Processes: Branchenspezifika (z.B. Finanzen, Materialwirtschaft/Lagerung,
Auftragsverwaltung)
- Applications: Fachkomponenten
Betriebliche Anwendungssysteme
Anwendungssoftware dient direkt der betrieblichen Leistungserstellung
und wird vom Endbenutzer bedient. Basissoftware wird für den Betrieb
von Anwendungssoftware benötigt und wird von Systemadministratoren bedient,
z.B. Betriebssysteme, Entwicklungswerkzeuge, System-Utilities, Datenbanksysteme,
Shells...
Standardsoftware
- Aufwand für vorbereitende Dienstleistungen ist geringer (Systemanalyse,
Systementwurf, ...)
- Anschaffungskosten < Entwicklungskosten
- geringes Fehlschlagsrisiko
- kostet aber auch was: Customizing, Schulungen etc.
- für Standardaufgaben wie Buchhaltung, Personalwirtschaft etc.
Individualsysteme
- maßgeschneiderte Systeme
- geringerer Schulungsaufwand
- kein Customizing notwendig
- für alle Aufgaben, aus denen sich Weffbewerbsvorteile ergeben
Die betriebliche Softwarelandschaft ist ein integrierter Verbund
von Standard- und Individualsystemen. Integrierte Standardsoftware übernimmt
dann Rolle eines Anwendungs-Framework.
Vertikale Standardsoftware (Standardsoftware im eigentlichen Sinne)
ist eindeutig bestimmten Bereichen zugeordnet, z.B. der Produktion. Horizontale
Standardsoftware (= Endbenutzerwerkzeug) wird bereichs- und firmenzweckunabhängig
eingesetzt, z.B. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Desktop-Datenbanksysteme,
Grafikprogramme (pixel-orientiert, Vektor-Grafiken, Business-Graphics), Desktop-Publishing-Programme
(DTP - z.B. Seitenlayout in Zeitungen), Präsentationsprogramme, Integrierte
Pakete.
Unter Customizing (dt.= kundenindividuelle Anpassung) versteht man die
Anpassung von Standardprogrammen an anwenderspezifische Gegebenheiten durch
das Einstellen von Parametern nach betriebsspezifischen Vorgaben und Verarbeitungsregeln.
- Parametrisierung: Preferences einstellen; klassische "Anpassen..."-Option
- Benutzerschnittstelle ändern: Menüs, Symbolleisten, Shortcuts
- Funktionale Erweiterungen / Änderungen: Makrosprachen, Programmierschnittstellen
(User-Exits, DLLs, XCMDs ...)
Computer Supported Cooperative Work (CSCW) ist die Bezeichnung des Forschungsgebiets,
das interdisziplinär untersucht, wie Individuen in Arbeitsgruppen zusammenarbeiten
und wie sie dabei durch Informations- und Kommunikationstechnologie unterstützt
werden können, um die Effektivität und Effizienz der Gruppenarbeit
zu erhöhen (Teufel et al. 1995). Dimensionen des CSCW:
- informationstechnisch: Entwicklung von Werkzeugen, mit denen Gruppenarbeit
effektiv und effizient unterstützt wird
- sozial- und wirtschaftswissenschaftlich: Entwicklung von Arbeitsmethoden
und Techniken, die für diese Art der Arbeitsorganisation zweckmäßig
sind; Evaluierung der ökonomischen und sozialen Konsequenzen von Gruppenarbeit
- psychologisch/organisationstheoretisch: Schaffung eines umfassenden Verständnisses
psychologischer und organisationstheoretischer Grundlagen der Gruppenarbeit
Workgroup Computing
Auf Basis von Untersuchungen der Interaktionsbeziehungen zwischen Gruppenmitgliedern
sowie deren aufbauorganisatorischer Implementierung:
- Planung des Technologieeinsatzes unter organisatorischen Prämissen
- Konzeption von Computernetzen
- Bereitstellung von Basistechnologie
Groupware
| Zeit/Ort |
Gleich |
Verschieden |
| synchron |
- Electronic Meeting Systems (EMS: beschlossene Dinge müssen auch
durchgeführt und verfolgt werden)
- Group Decision Support Systems (GDSS)
|
- Collaborative Authoring Systems
- Screen Sharing Systems
|
| asynchron |
- Personal Information Manager (PIMs)
- Time Scheduler
- Calendaring Systems
|
- E-Mail/Conferencing
- Information Sharing Systems
- Workflow-Systeme
|
Funktionsbereiche
- Unterstützung der Kommunikation zwischen Gruppenmitgliedern
- Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern: Teilergebnisse
einzelner Teammitglieder zu einem Gesamtergebnis zusammenfügen
- Koordination von Aktivitäten: bei der Zusammenarbeit im Team werden
gewisse Reihenfolgen und Abhängigkeiten von Einzelaktivitäten beachtet
Funktionalität von Groupware-Systemen
- Kommunikation: hierzug gehört Empfang, Versand und Strukturierung von
Emails
- Zugriffsmanagement (Directory Service): Einrichtung von Benutzern und Benutzergruppen,
Vergabe von Privilegien auf Arbeitsobjekten, Definition von Rollen
- Kalender- und Terminierungsfunktion: Funktionen mit Calendaring Systems
und Time Schedulern
- Elektronische Diskussionsforen: asynchrone Diskussion mit Emails und Antwortstruktur
- Dokumentmanagement: Organisation von Dokumenten (Ablage), termingerechte
Bereitstellung (Wiedervorlage), Dokumentrecherche
- verteiltes Aufgabenmanagement: Formulierung, Verteilung und Terminierung
von Aufgaben; Überwachung des Bearbeitungsstatus (Historienfunktion)
- Workflowunterstützung
ERP-Systeme
- ERP = Enterprise Resource Planning
- integrierte betriebliche Standardsoftware
- für alle Unternehmensbereiche
- für alle Branchen
- über alle aufbauorganisatorischen Ebenen
- offen für zwischenbetriebliche Integration
- offen für die Integration von Individualsoftware
Funktionsbereiche (Beispiele):
- Logistik: Vertrieb, Materialwirtschaft, Produktionsplanung, Qualitätsmanagement,
Instandhaltung
- Personalwesen: Personalwirtschaft
- Rechnungswesen: Finanzwesen
- Controlling: Treasury, Anlagenwirtschaft
- Querschnittsaufgaben: Projektmanagement, Servicemanagement, Bürokommunikation,
Workflowmanagement, Data Warehouse
- Branchenlösungen
Teilsysteme:
Administrationssysteme
- operative Systeme zur Rationalisierung der Massendatenverarbeitung
- automatisierte und beschleunigte Abarbeitung von Routineaufgaben, z.B. Buchen
von Überweisungen in Banken
Dispositionssysteme
- wie Administrationssysteme plus Entscheidung(svorbereitung); dialogorientiert
- automatisierte Entscheidungen nur dann, wenn gilt, dass sie entweder besser
als die des Menschen (Anwendung von Optimierungsmodellen) oder gleichwertig
sind (Rationalisierung wird durch Entlastung der Entscheidungsträger
erreicht)
Probleme der Optimierungsrechnung
- Bestandteil der IIV ist eigentlich eine integrierte Optimierungsrechnung
zur Vermeidung von Suboptima
- Komplexität realer Modelle sprengt aber den Entscheidungsraum
- Versorgung mit vollständigen und genauen Daten unrealistisch
- Dispositionssysteme basieren daher vornehmlich auf heuristischen Verfahren
- Spezialfall Beratungssysteme
Planungssysteme
- Planung ist die Ermittlung von Sollvorgaben aus Vergangenheitsdaten
(strategische Planung kann über 40 Jahre gehen --> Informationsmangel)
- Entscheidungen auch bei schlecht strukturierten Problemen
- keine vorgegebene Periodizität
- Planungsmodelle erstellt das Top-Management
- Entscheidungsfindung durch Mensch-Maschine-Dialog
Kontrollsysteme
- für die Überwachung der Einhaltung von Plänen
- weisen ggf. auf einzuleitende Maßnahmen hin
- Funktionsprinzip: "Symptomerkennung - Diagnose - Therapievorschlag
- Therapieprognose"
Funktionen und Prozesse in Industriebetrieben
- Forschung sowie Produkt- und Prozessentwicklung (F&E)
- Vertrieb
- Beschaffung
- Lagerhaltung
- Produktion
- Versand
- Kundendienst
- Finanzen
- Rechnungswesen
- Personal
- Gebäudemanagement
Forschung und Entwicklung (F&E)
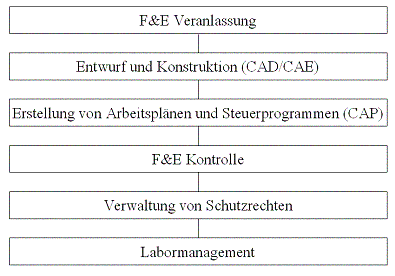
F&E Veranlassung
- Übernahme von Rahmeninformationen aus strategischer Planung
Projekt
- Aufgabenstellung(en) ohne Lösungsvorgaben - gab es in der Form noch
nicht
- Zeitrahmen und -puffer
- Budget
- Ressourcen
- Vorgehensmodell und -vorschriften
- Dokumentationsrichtlinien usw.
- keine Routine!
Entwurf und Konstruktion (CAD/CAE)
CAD-Systeme
- CAD - Computer Aided Design
- Unterstützung des Konstruktionszeichnens ("intelligentes Reißbrett")
- Zeichnen absolut maßstabsgetreuer geometrischer Figuren durch Angabe
weniger Parameter
- Ausblenden verdeckter Kanten
- Schraffuren von Flächen
- 3D-Effekte usw.
CAE-Systeme
wie CAD-Systeme, zusätzlich:
- ganzheitliche Sicht auf Baugruppen oder Endprodukte
- Formeln, Algorithmen und Tabellen für Berechnungen physikalischer Eigenschaften
- Simulationsmöglichkeiten
Konstruktionsinformationssysteme
- Ergänzung um betriebswirtschaftliche Informationen
- Schnellkalkulation
- Unterstützung des Target Costing: statt "Technische Realisierung
- Kosten - PUG" "Preisvorstellung - Kostenobergrenze - Technische
Realisierung"; Prinzip der konstruktiven Verschlankung
- Vorschläge von Alternativteilen: Standardteile; unterschiedliche Eigenschaften
bei gleichem Verhalten
- Machbarkeitsanalysen: Kritiksystem; Ressourcenverfügbarkeit
- Recherchen in Fachliteratur
- Generierung von Stücklisten und Arbeitsplänen
- Erzeugung der technischen Dokumentation
Erstellung von Arbeitsplänen und Steuerprogrammen
(CAP)
CAP (Computer Aided Planning)
- Planung der Arbeitsschritte zur Fertigung eines Werkstücks
- Erstellung bzw. Ableitung von Steuerungsprogrammen für NC-(numeric
control), DNC- (digital ~), und CNC-(computer control NC) Maschinen: Merkmale
und Ausprägungen von Teilen; Eigenschaften von Maschinen
Arbeitspläne
Ein Arbeitsplan beschreibt eine Folge von Verrichtungen (Arbeitsgängen),
die für die Herstellung eines Teils erforderlich sind. Mögliche Verrichtungen
sind als Verfahren klassifiziert. Unteilbare Verrichtungen werden auch Arbeitsschritte
genannt.
Arten der Arbeitsplanung:
- Wiederhol- bzw. Ähnlichteilplanung: gespeicherte Arbeitspläne
werden ggf. modifiziert und weiterverwendet
- Variantenplanung: Arbeitspläne werden für Teilefamilien bzw. Werkstückgruppen
erstellt; variantenspezifische Arbeitspläne werden durch Parametrisierung
der erstellten Pläne erzeugt
- Neuplanung bzw. generative Arbeitsplanung: Entwicklung des Arbeitsplans
durch Interpretation des CAD-Werkstückmodells; Automatisierung durch
Einsatz von Entscheidungslogik
Erstellung und Pflege von Arbeitsplänen
- Erzeugung von Fertigungsvorschriften: Kopieren einer Vorschrift von ähnlichem
Produkt und Änderung einzelner Bestandteile; automatische Übertragung
von Änderungen auf andere Vorschriften; Löschen von Teilketten
- Anlage von Sekundärindizes auf Maschinen, Vorrichtungen (damit Maschine
arbeiten kann) und Material (wird bei Produktion verbraucht)
Integrationsbeziehungen
- CAD: (automatische) Ableitung von NC- Programmen aus CAD-Daten
- CAM (Computer Aided Manufacturing): Simulation mit dreidimensionalem Umweltmodell
für die Roboterprogrammierung
- PPS (Produktionsplanung und -steuerung): Arbeitsvorbereitung
F&E - Kontrolle
Budgetverfolgung
- Personenstundenerfassung: projektbezogene Stundenaufzeichnungen
- Materialverbrauch: Schnittstelle zur Materialwirtschaft und Lagerhaltung;
F&E als eigene Kostenstelle
- Budgetüberwachung: Alerts bei Über- und Unterschreitungen
Terminverfolgung (Projektmanagementsystem)
- Projekt wird in Arbeitspakete zerlegt und Ressourcen zugeordnet
- wichtige Termine, an denen Aktivitäten aus parallelen Arbeitspaketen
zusammenlaufen, definieren Meilensteine
- Termine sind mit Puffern versehen (FrühesterStart - LetzterStart,
FrühestesEnde - LetztesEnde)
- Alerts bei Über- und Unterschreitungen von Budgets und Terminen
Qualitätskontrolle
- Fehler haben Konsequenzen: Gefahr für Leib und Leben (Kern-, Medizin-,
Umwelt- oder Weltraumtechnik); verursachen (erhebliche) Kosten (Rückrufaktionen,
Regreßforderungen usw)
- Produktqualität ist kritischer Erfolgsfaktor: deutsche Unternehmen
verfolgen in der Regel Differenzierungsstategie im Wettbewerb
FMEA-Methode
- FMEA = Failure Mode and Effects Analysis
- Zusammenfassung der Gedankengänge qualitätsbewußter Konstrukteure:
Welche Fehler können auftreten? Welche Konsequenzen haben sie?
- Darstellungsmittel: Checklisten (z.B. im Cockpit vor dem Start), Strukturbäume,
Workflows für Qualitätssicherungs-Pläne
Module der FMEA
- Auflistung aller möglichen Fehler
- Konsequenzen von Fehlern aus Kundensicht: Zuordnung von Fehlern zu Konsequenzen;
Gewichtung der Fehler (Unbequemlichkeit, Belästigung, Fehlfunktion (es
passiert etwas, was nicht passieren dürfte), ..., Super-Gau )
- Auflistung aller möglichen Fehlerursachen und verantwortlicher Instanzen:
Verknüpfung mit Fehlern; Kaskaden von Fehlern, Fehlerbäume
- Auflistung aller Kontrollmaßnahmen, mit denen Fehlerursachen entdeckt
werden können (z.B. Blackbox)
- Schätzung der Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Fehlerursache:
Bewertung mit der Skala 1 bis 10 (10 = sehr hoch)
- Bewertung der Folgen eines Fehlers aus Kundensicht: auch Skala 1 bis 10
- Schätzung der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Fehler entdeckt wird,
bevor das Produkt den Kunden erreicht: Skalierung von 10 bis 1 (1 = hohe Wahrscheinlichkeit)
--> "Bananenstrategie" (Produkt "reift" beim Kunden)
--> Kunde als Tester
- Multiplikation der Bewertungspunkte führt zur RPN (Risk Priority Number)
Schwäche des Verfahrens
- Produktlebenszyklus bleibt unberücksichtigt, stattdessen nur die Entwicklungsphase
- Nutzungshäufigkeit und -intensität
- Wartungszyklen
- sonstige Einflußfaktoren auf die Fehleranfälligkeit
- Fragen der Produkthaftung (auch seltene Fehler können sehr teuer werden)
- heute: Kreislaufwirtschaftsgesetz
Verwaltung von Schutzrechten
- Schutzrechte betreffen: Patente (geistiges Eigentum), Geschmacks- und Gebrauchsmuster,
Marken (früher Markenzeichen, z.B. Namen, Zeichen)
- Aufgaben: Recherchen in Patentdatenbanken ( und elektronischen Markenblättern);
Termin- und Fristüberwachung
- in der Regel Sache von Patentanwälten (z.B. Schneiders Semantomark)
Labormanagement
- Unterstützung der Planung und Durchführung von Versuchen
- Verwaltung von Laboraufträgen
- Verwaltung und Erzeugung von Arbeitsplänen
- Statistische Versuchsplanung: Minimierung des Versuchsumfangs durch Festlegung
sinnvoller Stichprobe oder Rückgriffe auf vorhandene Ergebnisse
- Versuchssteuerung: Anstoß automatisierter Prozesse; Messung und ggf.
periodische Auswertung (Story zum Botanischen Institut)
- Statistische Behandlung der Ergebnisse
- Dokumentation der Ergebnisse
- Kalkulation des Versuchsaufwandes für die innerbetriebliche Leistungsverrechnung
Was ist ein Auftrag?
- definiert grundsätzlich eine Beziehung zwischen Kunde und Lieferant
- Dimensionen: Auftragsart, Auftragsnummer, Datum, Liefertermin(e), Kundendaten,
Lieferantendaten, Leistung(en) (auch Auftragspositionen: bestehen mind. aus:
Menge, Art, Preis), Lieferbedingungen
Vertrieb
- Anwendungssysteme unterstützen Vertriebsmitarbeiter und Außendienstler
bei der Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Kundenkontakte
(Ergebnis: Angebot)
- Angebotsüberwachung
- Auftragserfassung und -prüfung (Auftrag annehmen oder ablehnen)
- Vertriebscontrolling
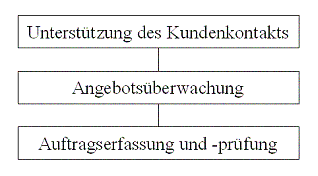
Unterstützung des Kundenkontakts
Planung - Vorbereitung - Durchführung - Nachbereitung
Planung des Kundenkontakts
- Kundenkontakte entstehen durch Anfragen oder als Reaktion auf unaufgeforderte
Angebote
- IT-Unterstützung ist also sinnvoll, wenn eine große Anzahl von
Anfragen und Angeboten bearbeitet werden muss oder wenn die Kundenanfragen
Schnittstellen zur Produktkonfiguration und Kalkulation haben
Kundenkontakt - Angebotsauswahl (welcher Kunde bekommt ein Angebot?)
- Aufwand für die Angebotserstellung
- Trefferquote des Kunden
- Autragsvolumen
- Checklisten: Haftungsbegrenzungen, Finanzierung erforderlich?, Marktpreisniveau
etc.
- Vertreterbesuch erforderlich?
Management des Außendienstes - Entscheidungsregeln
- Orderverhalten in der Vergangenheit
- Besuchshäufigkeit
- Marktpotentiale sind nicht ausgeschöpft
- Kunde ordert möglicherweise Produkte, deren Lagerabgang besonders erwünscht
ist
- Kunde ist gemäß Betreuungszyklus "dran"
- Angebot ist nachzufassen
- "Türöffner" existiert (z.b. neues Produkt)
Methoden der Kundenbewertung
- ABC-Analyse: A-Kunden haben hohe Trefferquote und kaufen häufig; C-Kunden
haben niedrige Trefferquote und kaufen seltener; B-Kunden sind dazwischen
- Kombinierte Preis-/Besuchspolitik: Arbeitszeit der Vertriebler ist knappe
Ressource (Zielfunktion: DB max!)
- Kundenportfolios: wichtig sind größere Stammkunden, die den Grundumsatz
sichern; am wichtigsten ist es aber, Kunden zu akquirieren, die bisher nur
wenig kaufen, aber ein starkes eigenes Wachstum aufweisen (also hier am meisten
Arbeit investieren)
- Normstrategien: festgelegte Regeln, über die Kunden betreut werden
sollen
Vorbereitung des Kundenkontakts
Bereitstellung von Kundeninformationen
- Akquisitionspotential: Kundendaten, Projektberichte, Soll-Ist-Vergleiche,
Prognosen - Reklamationen, Retouren, Zahlungsmoral, Rabattierungen, Mustersendungen
- Preis- und Produktdaten
- Produktkonfiguration: Software zur Konfiguration mit dem Kunden (siehe Autohaus)
- Achtung: Liquidität sichern!
Produktorientiertes Vorgehen
- Ziel: möglichst Produkte verkaufen, die unterbelastete Kapazitäten
bei maximalem Deckungsbeitrag ausfüllen (Bestimmung des optimalen Ergänzungsprogramms
mittels LP)
- Sonst: Produkte forcieren, die vom Kunden in der Vergangenheit stärker
gefragt waren, als zuletzt oder solche, die länger nicht mehr gekauft
wurden
Durchführung des Kundenkontakts
Ziele: möglichst gute Bereitstellung von Fachinformation für
Außendienstler im Kampf an der "Buying Front"; Bereitstellung
von Informationssystemen für Kunden, mit denen Produkte ausgewählt
und konfiguriert werden können
Verkaufsunterstützende Systeme - Funktionen
- gezielte Online-Recherche nach Fachinformationen
- Vorgaben von Prioritäten gemäß gesamtbetrieblichem Optimum
- Konsistenzsicherung von Angebotspositionen
Elektronische Produktkataloge (EPKs)
- vertriebs- und kundengerechte elektronische Präsentation des aktuellen
Produktangebots
- Technologien: Basis: Produktdatenbank; Repräsentation: Multimedia-
und Hypermedia-Systeme, VRML-Demos; Navigation durch Explosionszeichnungen;
jederzeit repräsentativer Ausdruck möglich
- erfordern eine permanente Aktualisierung: Kopplung mit Warenwirtschaftssystem
(Aktualität von Preisen und Beständen); Dynamische Generierung der
Web-Inhalte
- Suchsystem
- Klassifikationssystem
Integration verschiedener Online-Kataloge
- Situation: verschiedene herstellerspezifische Online-Kataloge verfügbar
- Ziel: neutraler, herstellerübergreifender Online-Katalog, der herstellerspezifische
Online-Kataloge auf der Grundlage einer standardisierten Struktur zusammenfasst
- Problem: noch keine umfassenden Standards
- aber erste Erfolge: Tourismusindustrie, (Flug-)Reservierungssysteme
Angebotssysteme - Funktionalität
- Präsentation eines Produktes (EPK)
- Selektion und Konfiguration von Bauteilen, Extras usw.
- (Schnell-) Kalkulation
- Ermittlung des Angebotspreises
- Nachweis und Analyse von möglichen Subventionen
- Finanzierungsvorschlag
- Abschätzung der Folgekosten
- Erfassung der Angebots- und Auftragsdaten
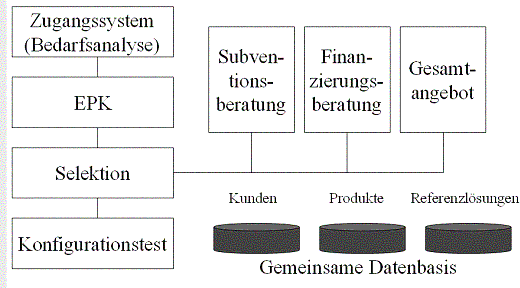 Architektur eines
Angebotssystems
Architektur eines
Angebotssystems
Elektronische Märkte
- das Angebot unterschiedlicher Anbieter wird entweder unter regionalen oder
unter branchenbezogenen Gesichtspunkten unter einer einheitlichen Bedienerkonzeption
zusammengefasst (vgl. Portale)
- möglichst alle Phasen einer Markttransaktion (Informationsbeschaffung,
Handeln, Vereinbaren, Zahlen, Liefern etc.) werden unterstützt
- nur erfolgreich, wenn es vom Kunden wahrgenommene Mehrwerte gibt
(Preis, großes Angebot etc.)
Ein Portal ist die fachspezifische Zusammenfassung von Anbietern, ähnlich
der E-Mall, z.B. Versicherungsportal.
Electronic Shopping
- Angebot wird im WWW unter einheitlicher Schnittstelle dargestellt (Electronic
Mall); Standard(s) für EPKs erforderlich
- Prinzip des Elektronischen Einkaufskorbs: Kunde stellt seinen Einkauf aus
dem Angebot verschiedener Anbieter zusammen
- Zahlung erfolgt an der Kasse der Electronic Mall
- Beispiel: Electronic Mall Bodensee (EMB)
- wenig erfolgreiche Hybridlösungen: z.B. Karstadt mit Katalogen auf
CD für zu Hause... (Aktualität?)
Customer Relationship Management (CRM)
- Individualisierung des Leistungsangebots
- Pflege von Kundenprofilen: Systematische Beobachtung des Kundenverhaltens
(vgl. web usage mining); Dokumentation von kundenindividuellen Eigenschaften
- One-to-One-Marketing: z.B. SelbstKonfigurieren eines Portals (welche Informationen
sollen mir zuerst angezeigt werden?)
- Online Shops
- Mass Customization (vgl. www.mass-customization.de)
Profil-Management
- Zweck von Profilen: Gewinnung kundenbezogener Daten aus deren Online-Transaktionen
- Datenquellen für die Profilbildung: Besuchsdaten (einer Web-Site);
Kommunikationsaktivität; Transaktionsdaten
Verwendung von Profilen
- gezielte Platzierung von Werbebannern
- gezielte Zuschaltung von Content Providern bei Portalen
- Vermeidung/Vereinfachung langwieriger Registrierungsprozeduren bei Erkennung
eines bekannten Kunden
Qualität der Profildaten
- anonyme Daten: Informationen, die aus dem Bewegungsprofil (innerhalb oder
zwischen Web-Sites) eines Nutzers abgeleitet werden können
- Kundendaten niederer Verbindlichkeit: Kunde bekannt durch Ausfüllen
eines Formulars oder durch E-mail; Problem: Angaben sind nicht authentifiziert
(z.B. indiana@jones.de)
- Kundendaten hoher Verbindlichkeit: Entstehen i.d.R. bei Abschluss einer
Transaktion; den Daten liegt eine Authentisierung zu Grunde
in Profilen enthaltene Informationen:
vom Nutzer (Kunden) bewusst bereit gestellte Daten
- Persönliche Daten: Adresse, Angaben zur Person,...
- Sicherheitsbedarf: Verschlüsselung, Authentisierung,...
- (Kunden-)Präferenzen: Interessensgebiete, Preisvorstellungen, ...
- Kommunikationsparameter: Bandbreite, Viewer, ...
vom Anbieter abgeleitete Daten
- Sitzungsdauer: Dauer der Nutzung eines Angebots, Verweildauer auf einer
Web-Site, ...
- Transaktionsdaten: Artikel, Anzahl, Datum, ...
- Warenkorb: Kombination erworbener Produkte
- Hits: Anzahl der HTTP-Zugriffe auf ein Objekt (Bild, Frame ...)
- Click-Streams: Navigationspfad des Nutzers durch eine Web-Site
- AdClicks: Häufigkeit, mit der ein Werbebanner angeklickt wurde
- getätigte Anfragen
Techniken zur Profilbildung
- Data Mining: Auswertung von Log Files, z.B. auch in ERP-Systemen (Extraktion
von nichttrivialen Informationen aus Massendaten)
- Cookies: Zweck: Realisierung zustandsbehafteter Sitzungen; erlaubt dem Web-Anbieter,
Daten auf dem Rechner des Kunden zu hinterlegen; Problem: Verwendung ist umstritten
(Cookies, die sich ohne Erlaubnis herunterladen und installieren, sind keine!)
- vCards: standardisierte Visitenkarte
- Open Profiling Standards (OPS): Datenformate und Übertragungsverfahren
zur Vereinfachung von Online-Registrierung und Online-Transaktionen; Steuerung
der Zugriffsrechte auf das eigene Profil durch den Kunden
- Platform vor Privacy Preferences Protocol (P3P)
Besondere Probleme
- Preiskalkulation kann bei stark kundenorientiertem Angebot nicht auf Basis
von Listenpreisen oder Zuschlagskalkulationen ermittelt werden (Lösungsansatz:
Nutzung von Methoden des CaseBased Reasoning)
- Yield Management: Alert-System mit Entscheidungsregeln gemäß
Kazazitätsauslastung (z.B. LastMinute)
One-to-One-Marketing
- Zweck: aus Profildaten abgeleitete kundenindividuelle Werbung
- Vermarktung von Kundenprofilen durch spezialisierte Unternehmen (Information
Broker)
- Kombination von Kundenprofilen mit demographischen und geographischen Daten
(Einkommensniveau, ländl./städtische Region,...)
Recommendation Engines
- Zweck: Automatisches Vorschlagen komplementärer oder zusammengehöriger
Produkte
- Beispiele: Amazon: "Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch
eines der folgenden Bücher erworben..."; Zwei-Warenkörbe-Ansatz:
der erste Warenkorb enthält die vom Kunden ausgewählten Produkte,
in den zweiten werden automatisch komplementäre Produkte einsortiert
Online-Shops:Anforderungen
- Vertriebene Produkte: Greifbare Produkte (Hard Goods): Integration der Shop-Systeme
in das Warenwirtschaftssystem erforderlich; Digitale Produkte (Soft Goods:
Software, digitale Bücher, Audio/Video Clips/Streams, Schriften,...):
Notwendigkeit zur sofortigen Bezahlung, Bereitstellung des Produkts (Download
bzw. kontinuierlicher Zugriff bei Streams), Möglichkeit zur (nutzungs-)zeitbasierten
Abrechnung
- Kaufverhalten: Unabhängigkeit von Ort und Zeit; Notwendigkeit flexibler
und leistungsfähiger Suchmechanismen bei umfangreichen Angeboten (Geduld
des Kunden)
- Produktinformation: Aussagekräftige Produktbeschreibung (Kommentare
anderer Käufer, Empfehlungen, ...), Produktproben (Auszug eines Buchs,
Teil eines Videos, Screenshots, ...)
- Bereitstellung eines Einkaufskorbs: Problem: HTTP ist zustandslos (Zustand
des Korbes verändert sich ja!); Realisierung zustandsbehafteter Verarbeitung:
Cookies, Session ID: Integration einer Session ID in die (benutzerindividuell
generierte) HTML-Seite, sodass diese bei einer Benutzerinteraktion wieder
an den Anbieter zurückgeschickt wird, der Warenkorb kann damit einfach
auf der Server-Seite (in der DB des Online-Shops) gehalten werden
- Identifikation des Kunden: Abfrage von Kundendaten bei Bezahlung z.B. über
Formulare (Vermeiden, den Kunden zu zwingen, zu viele Daten herauszugeben!)
- Bezahlung: Berücksichtigung von kundenbezogenen Konditionen; Verwaltung
von Sonderangeboten, sichere Übermittlung der zahlungsbezogenen Daten
- Finalisierung der Transaktion: Verbindung zum Payment Gateway (hier: Server
der Kreditkartengesellschaft); Erkennung von Junk Orders (No Name, Donald
Duck etc.): Schwarze Listen, Problemkundenverzeichnisse,... (Erfahrungswerte
des traditionellen Versandhandels nutzen!); Bestätigung an den Kunden
(Email, Ausdruck); Bereitstellung von Tracking-Informationen (Fertigstellungsstatus,
Aufenthaltsort der Ware ...)
- Statistische Auswertungen, Data Mining (Generierung von Profilen)
- Elektronischer Datenaustausch: Integration mit den Zulieferern
- Customer-Relationship-Management, Call-Center-Integration: Bereitstellung
von Kundeninformationen auf Knopfdruck
- Suchmaschine
- Integration mit betrieblichen Anwendungssystemen (v.a. Finanzbuchhaltung,
Warenwirtschaft)
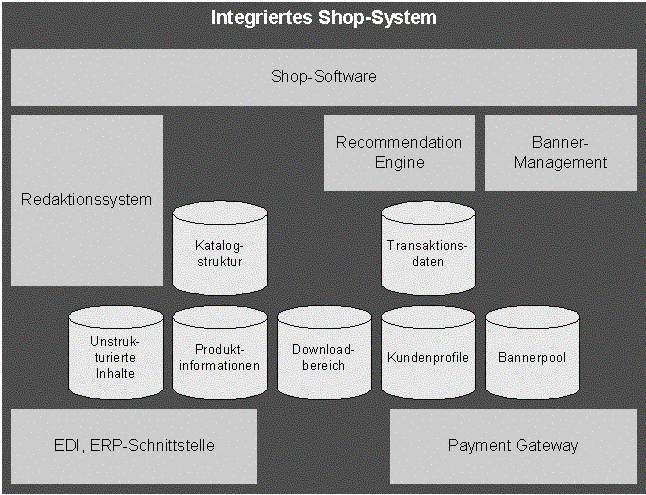 Bestandteile eines
Shop-Systems
Bestandteile eines
Shop-Systems
Mass Customization (Kundenindividuelle Fertigung zu Preisen der Massenfertigung)
| Soft Customization |
kein Eingriff in die Fertigung, Individualisierung erfolgt außerhalb
der herstellenden Unternehmen |
|
| Service Customization |
Ergänzung eines Standardprodukts um kundenindividuelle Dienste |
Ergänzung um Beratung, technischer Kundendienst |
| Selbstindividualisierung |
Individualisierung erfolgt durch den Kunden oder das Produkt selbst (z.B.
RitterSport) |
Intelligente Bauteile (Netzteile), Bespielbare Glückwunschkarten |
| Kundenspezifische Endproduktion (point of delivery customization) |
Kundenspezifische Endproduktion vorgefertigter Produkte durch den Händler |
Skischuhe (Dynafit, Technica, Nordica) |
| Hard Customization |
Eingriff in die Fertigung notwendig |
|
| Modularisierung |
Standardisierte Module werden kundenindividuell kombiniert |
PC (Vobis, Dell, Gateway), individuelle Medien (Bücher, Zeitschriften),
Fahrräder (Panasonic) |
| Massenhafte Fertigung von Unikaten |
|
Werkzeuge (Sandvik Coromant), Möbel, Ventile (Ross Controls) |
| Kundenspezifische Vor- oder Endproduktion |
Kundenspezifische Vor- oder Endproduktion mit standardisierter Fertigung
in den übrigen Fertigungsstufen |
Bekleidungsindustrie, kundenindividueller Zuschnitt, kundenindividuelles
Design von Skiern |
==> "The winner takes it all" ==> der erste (mit einer neuen
Idee) auf dem Markt schöpft diesen auch ab!
Nachbereitung des Kundenkontakts
Erfassung von Besuchsberichten muss so effektiv wie möglich gestaltet
werden!
- gezielte Abfrage planungsrelevanter Daten
- möglichst viele vorgegebene Antworten
- elektronische Rückmeldung der Berichte
Angebotsüberwachung
- Alert-System zum Nachfassen von Angeboten
- Entscheidungsunterstützung: "weiterverfolgen oder nicht"
- Trefferquote: z.B. schon 100 Angebote ohne eine Bestellung?
- Angebot ohne Bestellabsicht (nur zur Info)
Auftragserfassung und Prüfung
Technische Prüfung - Bonitätsprüfung - Terminprüfung
Rationelle Auftragserfassung
- Offline über maschinenlesbare Belege
- Online ggf. in Verbindung mit CIT (Computer Integrated Telephony): Telefon
erkennt anhand von Durchwahl zuständigen Sachbearbeiter und stellt auch
Kundeninformationen bereit
- Fernübertragung via WWW: Bestellung wird reibungslos in Auftrag umgewandelt;
direkte Erfassung standardisierter Aufträge durch Kunden
- Erfassung durch Telefoncomputer (wenn Sie ... wollen, wählen Sie die
1 etc.): nicht praktikabel für umfangreichere Vorgänge
Auftragsprüfung
- nur zweckmäßig, wenn nicht bereits eine Angebotsprüfung
vorgenommen wurde
- Grundregeln: Aufträge werden angenommen; "Geht nicht" gibt's
nicht
- wichtig: Fristigkeiten von Aufträgen: Langläufer (kommen immer
wieder, z.B. halbjährlich) mit großem Volumen bieten Sicherheit;
Kurzläufer sichern die Liqidität
Technische Prüfung
- Ist das Produkt technisch realisierbar?
- Ist das Produkt bereits ausgelaufen / noch nicht im Produktionsprogramm?
- Werden irgendwelche Substanzen oder Materialien verwendet, die Exportbestimmungen
verletzen?
Bonitätsprüfung
- Statische Bonitätsprüfung: Kunde ist akzeptabel, wenn gilt: Summe
aus den Forderungen + Wert der noch nicht fakturierten Aufträge <
zugestandener Kreditrahmen
- Dynamische Bonitätsprüfung: Wird der Kreditrahmen im Zeitraum
bis zur Bezahlung des zu prüfenden Auftrags irgendwann überschritten?
z.B. bei häufigen großen Bestellungen/Aufträgen mit langem
Zahlungsziel
Dynamische Bonitätsprüfung
- Debitorenprogramm berechnet Zeitraum zwischen Rechnungsstellungsdatum und
Zahlungszeitpunkt
- aus den gesammelten Zeitwerten wird mittels Glättungsrechnung ein Erwartungswert
für die Zielinanspruchnahme des Kunden berechnet
- nun wird mit Hilfe folgender Daten berechnet, ob es zu irgendeinem Zeitpunkt
bis zur Zahlung zu einer Überschreitung des Kreditrahmens kommt: laufende
Forderungen, Erwartungswert für Inanspruchnahme des Zahlungsziels, beglichene
Rechnungen und deren Zeitpunkte, voraussichtliche Auslieferungstermine
- auch: wegen früherer Auffälligkeiten evtl. Vorkasse? (Zahlungsmoral)
Terminprüfung
Kann der vereinbarte Kunden-Wunschtermin eingehalten werden?
- Kann der Kunde aus dem Fertiglager bedient werden?
- Wenn nicht: Produktionswege verfolgen; Beschaffungszeiten von Fremdprodukten
berücksichtigen; Idealfall: "Produktionssimulation"
Terminprüfungsverfahren
- Engpaß-Verfahren: Abfrage der Verfügbarkeit von Rohstoffen, Zwischenprodukten
und Kapazitäten von Engpaßbetriebsmitteln; doppelte Terminierung
kritischer Fertigungsaufträge: sind Kapazitäten (mit genügend
Puffer) zwischen frühestem Start- und letztem Endtermin frei, wird der
Termin akzeptiert
- Hochrechnungsverfahren: mit Prognoseverfahren wird die mittlere Durchlaufzeit
kritischer Produktgruppen fortgeschrieben
- Summierungsverfahren: die Bearbeitungszeiten der Fertigungsaufträge
(Mittelwert bei sehr verschiedenen Produkten) werden summiert; Liegezeiten
werden pauschal addiert
- Gruppierungsverfahren: Kapazitäten werden gruppiert; Aufträge
werden gerastert; Kapazitätsbedarfe werden berechnet; Clusteranalyse
Beschaffung
Bestelldisposition - Bestelladministration - Lieferüberwachung
- Wareneingangsprüfung
Klassischer Dokumentenfluss: Bedarfsmeldung beim Kunden - Angebotsanforderung
- Angebot des Lieferanten - Bestellauftrag durch den Kunden - Auftragsbestätigung
durch Lieferanten - Lieferschein - Rechnung des Lieferanten - Anweisung (zur
Bezahlung) durch Kunden; zwischendurch evtl. Reklamation
Bestelldisposition
Lagerabgangsprognose - Ermittlung Bestellgrenze und -termin (Ermittlung Sicherheitszeit
und -bestand, Eilbestellungen, Umdisposition) - Ermittlung der Bestellmenge
- Bezugsquellensuche und Angebotseinholung - Lieferantenauswahl
(s,Q)-Politik: Wird beim Lagerabgang ein gewisser Meldebestand s unterschritten,
wird eine Bestellung mit einer Menge Q ausgelöst, die nach der Wiederbeschaffungszeit
tw geliefert wird. Bis dahin ist auch der Sicherheitsbestand
z (Puffer) im Lager erreicht, der noch für die Sicherheitszeit tz
reichen würde.
Losbildung: Ziel ist die kostengünstige Zusammenfassung mehrerer
Periodenbedarfe. Hierfür existieren Unmengen von Modellen (Wie berücksichtige
ich z.B. Rabatte, Skonto etc.?). Von diesen sind jedoch nur wenige in PPS-Systemen
implementiert und haben daher nur eine eher geringe Relevanz für die Praxis.
Verfahren der Losbildung:
- Fester Periodenbedarf: keine Optimierungsrechnung sondern einfache Festlegung,
Speicherung im Teilestammsatz
- Klassisches Bestellmengen-/Losgrößenmodell: Andler-Formel
Andler-Formel
- x Bestellmenge bzw. Losgröße
- kr fixe Kosten pro Bestellvorgang bzw. Auflage des
Loses
- kl bestellmengen- bzw. losgrößenabhängige
Kosten
- y Gesamtbedarf im Planungszeitraum
- T Länge des Planungszeitraums
- optimale Losgröße x =
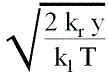
- Gesamtbedarf wird duch a-maliges Anfordern der Menge x befriedigt mit a
= y/x
Optimal?? - Restriktive Prämissen
- keine Kapazitätsrestriktionen bezüglich Lieferfähigkeit bzw.
Produktionsmöglichkeit
- Bedarf ist für gesamten Planungszeitraum bekannt und gleich
- Lagerabgang erfolgt kontinuierlich und mit konstanter Geschwindigkeit
- Einstandspreise bzw. Herstellkosten pro Mengeneinheit sind gegeben und mengenunabhängig
- bei Eigenfertigungszeiten gibt es keine Beziehungen zu Teilen auf anderen
Fertigungsstufen
Bestelladministration
Abstimmen von Kunden- und Lieferbeziehungen (Verwaltung von Bestellaufträgen,
Kontraktmanagement) - Zollabwicklung
Beschaffungssysteme
- Zweck: Bündelung von Beschaffungsvorgängen eines oder mehrerer
Unternehmen oder Abteilungen zur Kostenreduktion (Beschaffungsoptimierung,
Verbesserung der Einkaufskonditionen, Mengenrabatte)
- Beispiel: Beschaffungsbroker: Verwaltung eines Verzeichnisses, in das verschiedene
Unternehmen ihre Bedarfe eintragen
Ariba
- Ziel: überbetriebliche Zusammenführung von Anbietern und Nachfragern
im b2b Bereich
- Ariba unterstützt die Abwicklung von (Beschaffungs-)Transaktionen,
Community-Management, Online-Kataloge, Qualitätsbewertung von Anbietern
(durch Kunden)
- Teilnehmende Unternehmen installieren eine Ariba-Network-Software: Festlegung
des zu nutzenden Nachrichtenformats (XML-basiert, kann in verschiedene Formate
der teilnehmenden Unternehmen transformiert werden); Festlegung der akzeptierten
Zahlungsmethoden
Broker
- Zweck: Vermittlung zwischen Anbieter und Nachfrager hinsichtlich vorgegebener
Kriterien, z.B. Preis, Termin, Qualität
- stellt eine neutrale Instanz dar, die keinem Marktteilnehmer direkt zugeordnet
ist
- sammelt Angebote und Bedarfe und versucht, übereinstimmende zusammenzuführen
Trader
- bilden die technologische Grundlage für Broker-Systeme
- Trading: Prozess der dynamischen Auswahl passender Angebot-Nachfrage-Tupel;
Berücksichtigung komplexer Bedingungen (Preis < 1200 €, Termin
< 10.01.2002)
- einsetzbar für beliebige Paarungsprobleme: Güter, Dienstleistungen
etc.
Supply Chain Management (SCM)
- Problem der Lieferkette: Wer zuerst Leistung erbringen muss (Lieferant des
Lieferanten des Kunden etc.), erfährt es zuletzt
- Lösungsansatz: Weitergabe von Informationen aus der Bedarfsplanung
(PPS) mit standardisierten Formaten (z.B. XML/EDI)
Lieferüberwachung
Bestätigungen anmahnen (Angebote anmahnen, Auftragsbestätigunen anmahnen)
- Termine anmahnen (Liefertermine anmahnen, Fertigungstermine anmahnen)
Wareneingangsprüfung
Mengenkontrolle - Qualitätskontrolle - Rechnungsprüfung
Lagerhaltung
Materialbewertung - Lagerbestandsführung - Inventur - Lagersteuerung
Materialbewertung
Wertrechnung mit
- extern eingegebenen Preisen
- Bestellpreisen
- festen Verrechnungspreisen
- laufenden gleitenden bzw. geglätteten Durchschnitten
- FIFO-Regel
- LIFO-Regel
- Kostensätzen aus Nachkalkulation [regelbasierte Kombination], z.B.
Herstellkosten
Lagerbestandsführung
Buchung von Lagerzu- und abgängen
- Trivialfall: (fiktives) Gesamtlager
- sonst: Unterscheidung von Lagern und Lagerorten (Berücksichtigung von
Werkstattbeständen)
- Reservierungen (z.B. bei Ungewißheit über Angebotsannahme)
- Kontrolle ungeplanter Lagerentnahmen
Lagerhaltungsstrategien
- Freie Lagerung: pro Lagereinheit werden nur Erzeugnisse einer Art aufbewahrt
- Chaotische Lagerhaltung: unterschiedliche Teile an einem Lagerort
- Random-Lagerung: Teile werden dort eingelagert, wo sie geometrisch am besten
hinpassen
Inventur
Ziel: Soll-(elektronisch) Ist-(physisch) Abgleich von Beständen
Arten
- Stichtagsinventur
- Permanente Inventur (man glaubt zu wissen, wo sich was befindet) => was
ist mit Diebstahl, falscher Buchung von Wareneingängen?
Auslöser einer Inventur
- explizit durch Sachbearbeiter
- Höchstbestände überschritten (Ist Lager wirklich voll, oder
nur die Ausbuchung vergessen?)
- Mindestbestände sind unterschritten
- Buchbestände <0
- Bestimmte Anzahl Buchungen ist ausgeführt worden
- Stillstand des Bestands über einen gewissen Zeitraum
- Ablaufschema zu Bestandsaufnahme ist fest programmiert
- Zufallsmechanismus (=> Stichprobe)
Varianten in der Vorgehensweise - Inventurlisten
- Inventur mit Buchbeständen: Sachbearbeiter berechnet Bestandsdifferenz
vs. Sachbearbeiter gibt nur Ist-Bestand ein und ein Programm berechnet Differenz
- Inventur ohne Buchbestände: Sachbearbeiter gibt nur Ist-Bestand ein
und ein Programm berechnet Differenz
Lagersteuerung
Lagerhaussteuerung
- Kapazitätsplanung: maximale(s) Gewicht/Fläche/Fassungsvermögen
von Lagerorten wird beachtet
- Auslieferungsstrategien (z.B. LIFO, FIFO)
- Gefahrgutmanagement
Transportmittelsteuerung
- Hochregallager
- Gabelstapler
- Fahrerlose Transportsysteme
- Förderanlagen
- Fließbänder
- Fahrzeuge
- Gitterkästen
Materialflusssteuerung (ist die neue Rechtschreibung
nicht furchtbar?)
- Integration mit Produktionslenkung und Qualitätssicherung
- Lagerlose Fertigung (Bypass-Verfahren)
Versand
Zuteilung - Kommissionierung - Lieferfreigabe - Versandlogistik - Fakturierung
- Gutschriftenerteilung - Packmittelverfolgung
Prozessvarianten
- kaum/keine Teillieferungen: Lieferfreigabe nicht erforderlich
- keine besonderen Entscheidungen bei Versand: statt Versandlogistik nur Veranlassung
(Papiere drucken)
- Vorfakturierung: Lieferscheine überflüssig
- reine Kundenauftragserfassung: Zuteilung überflüssig
Zuteilung
- Zuteilung von Fertigwaren an Kundenaufträge
- Zuteilung von Halbfabrikaten zu Kundenaufträgen
- Zuordnung von Kundenaufträgen zu Produktionsstätten
- Auch: "Sammeln" (von Fertigmeldungen, evtl. nach Prioritäten)
Zuteilung von Fertigwaren
- einfachster Fall: Zuteilung nach Lieferterminen (bei mehreren Aufträgen
mit gleichen Terminen nach Kundenpriorität oder Auftragsvolumen)
- alternativ: Zuteilungsvorschlag deutlich vor Lieferterminen (manuelle Eingriffsmöglichkeit
gegeben)
- alternativ: Periodenbetrachtung: Reservierung von Beständen für
Terminaufträge, Zuteilung nur noch für disponiblen Fertiglagerbestand
- alternativ: Preemption-Strategie: bestimmte Aufträge können explizit
vorgezogen werden, wodurch andere in der Priorität fallen (vgl. Arztpraxis)
Kommissionierung
Zusammenfassung von Lagerentnahmen nach räumlichen Kriterien
- Reduzierung der Transportwege und Entnahmevorgänge: Sortierung der
Kundenauftragspositionen nach Lagerorten
- Entnahmeschübe
- Richtigkeitskontrolle: Nachwiegen einer Kommission
- Behälterauswahl nach Verpackungseinheiten
Lieferfreigabe
Überprüfung, ob die mit Lieferzuteilung erzeugten Lieferpositionen
auch zum Versand gebracht werden können
- Liefertermin ist erreicht und Lieferung komplett: Freigabe erfolgt
- keine Kundenauftragsposition ist lieferbar: Freigabe erfolgt nicht
- Teillieferung ist möglich: Freigabe??
(Entscheidungssituation:) Teillieferung erfolgt
- wenn bestimmter Prozentsatz der Bestellung geliefert werden kann
- Teillieferung wird als Gesamtlieferung betrachtet, wenn Restmenge bestimmten
Grenzprozentsatz unterschreitet (Stornierung auf später)
- Teillieferung hängt von Merkmal im Kundenstammsatz ab
- Konfiguration von Teillieferungen erfolgt nach logistischen Gesichtspunkten
- Kunde bekommt grundsätzlich alles, was lieferbar ist (außer es
sind z.B. erst 1,5 von 2 LKWs voll, dann kann man auch nur 1 LKW schicken
und dann später den zweiten...)
Versandlogistik
Festlegung eines optimalen Belieferungsplans der Kunden- und Außenlagerergänzungsaufträge
für n Kunden, m Außenlager, t Transportmittel und l Lager
Modellbausteine
- Auswahl der Auslieferungslager (falls noch nicht in Zuteilung erfolgt)
- Auswahl der Transportart
- Ermittlung der optimalen Beladung und Fahrtroute
- Verbesserung der Lösung durch Veränderung der Versandmengen (Teillieferungen
oder nicht fällige Kundenaufträge)
Versandlogistik-Prozess
Auslieferungslager bestimmen - Transportart bestimmen - Beladung bestimmen
- Fahrtroute bestimmen - Optimierungsmöglichkeiten prüfen - Versandpapiere
erstellen
jetzt ginge es noch weiter mit dem Prozess der Versandlogistik,
mehr als bis hier haben wir aber leider *g* nicht geschafft...
Nach Martin 1989 - 91, "Grüne-Wiese-Ansatz"
Monolithisches
System vs. 3-Schicht-Client-Server-System
Architektur
Application
Server als Middleware
Beispiel SAP/R3
Architektur
des Application Servers
Middleware als Dienstvermittler
Architektur eines
Angebotssystems
Bestandteile eines
Shop-Systems